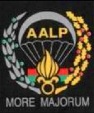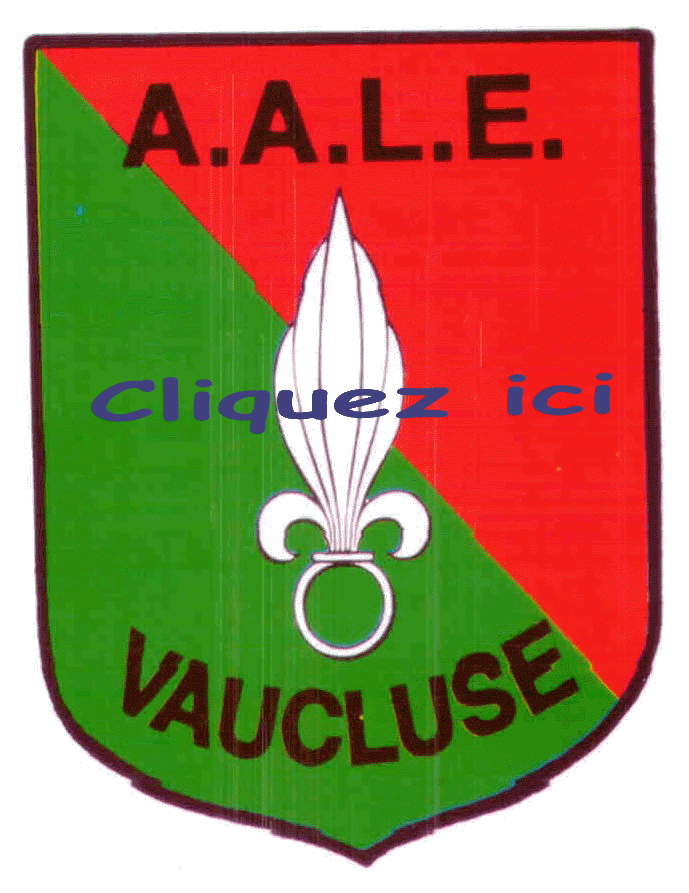Von Wolfgang Büscher
29. Dezember 2011
Er studierte Bauingenieurwesen, aber was er suchte, waren seine Grenzen. Gespräch mit einem, der zur Fremdenlegion ging

ZEITmagazin: Wie kam es zu dem Entschluss, ich breche alle Brücken ab und gehe zur Fremdenlegion – jener berühmt-berüchtigten Truppe internationaler Freiwilliger, die zur französischen Armee gehört?
Legionär: Die Idee ist lange gereift. Zwei Tage bevor ich nach Paris gefahren bin, habe ich mir die Fahrkarte geholt und mit mir gekämpft. Die Entscheidung, dort zu bleiben, stand nicht felsenfest. Die Chance, von der Fremdenlegion akzeptiert zu werden, ist nicht groß, nur jeder zehnte Bewerber wird genommen.
ZEITmagazin: Haben Sie das allein mit sich ausgemacht?
Legionär: Komplett mit mir selber. Ich habe niemandem gesagt, dass ich nach Frankreich gehe. Ich habe eine Pro-und-Kontra-Liste aufgestellt und dachte, wenn es nicht klappt, dann war es halt ein schönes Wochenende in Paris. Leider Gottes war ich nicht so gut informiert, wie ich glaubte. So kam es dazu, dass ich vier Monate lang komplett verschwunden war.
ZEITmagazin: Was heißt das?
Legionär: Zum Aufnahmeritual der Legion gehört es, dass einem der Kontakt nach außen komplett versperrt wird: kein Telefon, kein Internet, nichts. Und da ich niemanden informiert hatte, galt ich vier Monate lang als unauffindbar. Wie alle Bewerber in Paris ging ich zum berühmten Fort de Nogent. Man wird in ein Büro geführt, wo man einen neuen Namen bekommt und seine Dienstnummer. Dort wird einem alles weggenommen, der Ausweis, alle Papiere. Dann ging es nach Aubagne bei Marseille , da werden medizinische und psychologische Tests gemacht. Und es wird geklärt, ob man ein Straftäter ist. Die Institution, die das klärt, heißt im Jargon Gestapo.
ZEITmagazin: Gestapo, wie im Nationalsozialismus?
Legionär: Nur anders betont: Géstapó, genau.
ZEITmagazin: Was stand eigentlich auf Ihrer Positivliste?
Legionär: Die Erfahrung. Das Abenteuer. Versuchen, mich mir selbst zu beweisen.
ZEITmagazin: Kennen Sie den Gedanken: bei null anfangen – mal sehen, ob ich es schaffe?
Legionär: Es ging sehr stark darum, bei null anzufangen. Sich klar zu werden, was man psychisch, physisch in der Lage ist zu leisten.
ZEITmagazin: Wann wussten Sie, es gibt kein Zurück ?
Legionär: Auf der Fahrt nach Castelnaudary zur Grundausbildung. Ab dann ist man Soldat, man wird eingekleidet, der Umgangston wird härter. Du darfst zwei, drei persönliche Dinge mitnehmen, dann geht’s los. Die Ausbildung ist sehr hart. Nach der ersten Woche ist man so erledigt, dass man es kaum noch schafft, Gedanken an Privates aufrechtzuerhalten. Die Ausbilder schaffen es mit einer gewissen Methodik, einem das Denken zu nehmen. Man funktioniert nur noch.
ZEITmagazin: Welche privaten Dinge nahmen Sie mit?
Legionär: Zwei Familienfotos und den MP3-Player mit meiner Musik, der wurde mir gleich wieder abgenommen. Musik wäre ein Halt, die Ausbilder wollen das unterbinden. Auch die eigene Sprache ist verboten, es wird nur französisch gesprochen. Die zwei anderen Deutschen und ich wurden strikt getrennt, um zu verhindern, dass wir deutsch sprachen.
ZEITmagazin: Ihre Familie wusste nicht, wo sie waren?
Legionär: Nein. Sie hatte eine Vermisstenanzeige aufgegeben, über die Polizei, später über die Kripo, die aber wenig herausfanden. Erst ein Freund meines Vaters hat meinen PC durchleuchtet und festgestellt, auf welchen Internetseiten ich gesurft habe und dass eine der letzten die der Legion gewesen war.
ZEITmagazin: Konnten Sie später Kontakt herstellen?
Legionär: Wir haben uns durch den Zaun unserer Kaserne ein Handy besorgt, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Damit haben wir unsere Familien angerufen. Das war eigentlich verboten.
ZEITmagazin: Wie haben Ihre Eltern reagiert?
Legionär: Sie waren erleichtert, Gewissheit zu haben.
ZEITmagazin: Warum hatten Sie ihnen nichts gesagt?
Legionär: Ich habe überlegt, informiere ich meine Familie oder nicht. Ich glaube, ich habe es nicht getan, um mir keine Blöße zu geben, wenn ich scheitere. Im Nachhinein eine krasse Fehleinschätzung. Was man Familie und Freunden damit antut, ist eigentlich unverzeihlich.
ZEITmagazin: Wie lange dauerte die Grundausbildung?
Legionär: Vier Monate, davon einen Monat auf der »Farm«, das ist ein altes Gebäude, wo die Legionäre auf Kondition gebracht werden. Mit Unterernährung, wahnsinnig viel Stress und Schlafmangel wird versucht, den Menschen erst mal ihren Glauben zu nehmen, ihren Willen zu brechen. Man bricht sie, um sie dann wieder neu aufzubauen. Es klingt pervers, aber das ist die Methode, und sie funktioniert, das muss man leider sagen.
ZEITmagazin: Gab es noch Inseln, um bei sich zu sein?
Legionär: Nicht alles ist weg. Ich glaube, den Menschen im Innersten zu brechen und einen anderen Charakter aufzubauen ist sehr schwer. Das kriegt auch die Legion nur schwer hin. Die arbeiten hart daran, aber ich glaube, im Inneren bleibt man doch man selber. Man ändert bloß bestimmte Einstellungen zum Leben. Ich bin von meinen Eltern zu einem hilfsbereiten, höflichen und zuvorkommenden Menschen erzogen worden, und ich glaube, mir diese Eigenschaften zu nehmen, das hat die Legion nicht geschafft.
ZEITmagazin: Ihr Wunsch, an Ihre Grenzen zu gehen, sich kennenzulernen – hat er sich erfüllt?
Legionär: Ja.
ZEITmagazin: War es nur schrecklich oder auch gut?
Legionär: Es war auch gut. Es gab schreckliche Situationen, und man versucht im Nachhinein oft, sich das schönzureden. Obwohl mir das klar ist, weiß ich, dass ich dort schöne Zeiten verbracht habe. Man muss sich vorstellen, die Soldaten der Fremdenlegion kommen aus über 130 Nationen, rund um die Uhr ist man zusammengepfercht, in den besten Zeiten war ich mit 16 Nationalitäten auf der Stube. Das sind Erfahrungen, die man sonst kaum macht, dass Leute mit 16 politischen, religiösen und ethnischen Hintergründen so miteinander leben können, so aufeinander achtgeben, dieser Zusammenhalt ist eine sehr positive Erfahrung. Dazu meine persönlichen Erfahrungen: dass ich meine physische und psychische Belastbarkeit kennenlernte. Es gibt Momente im Leben, da sagt man, bis hierhin und nicht weiter. Was ich dort gelernt habe, ist, dass man sich seine Grenzen immer viel zu früh setzt – ein Selbstschutz, das ist nichts Schlechtes. Aber es geht weiter, es geht länger, das ist eine positive Erfahrung.
ZEITmagazin: Waren Sie in Kampfeinsätzen?
Legionär: Darauf möchte ich nicht antworten.
ZEITmagazin: Sie sprachen von schrecklichen Situationen – können Sie ein Beispiel geben?
Legionär: Da gibt’s mehrere. Man muss sich seinen Platz in der Legion erkämpfen. In Deutschland gab es Diskussionen, wie mit Soldaten umgegangen wird. Der Vorfall auf der Gorch Fock mit der Soldatin, die ums Leben kam, wurde stark kritisiert. Wenn ich das höre, denke ich immer, die werden mit Samthandschuhen angefasst. Was in der Legion an der Tagesordnung ist, ist mit der deutschen Armee nicht zu vergleichen. Das sind raue, harte Sitten. Es gibt so viele schöne Leitsprüche der Legion. Marschier oder stirb. Mach mit oder verrecke. Und so ist es im Endeffekt auch, sie wollen deine böse, harte Seite nach außen kehren, sie wollen, dass du dich durchbeißt. Und so ist es auch intern. Der hohe Dienstgrad versucht den niederen fertigzumachen, und der versucht sich zu wehren, indem er standhaft bleibt. Andere schlimme Erfahrungen musste ich in Afrika machen: Mitanzusehen, wie es den Menschen dort geht, hat mich sehr nachdenklich gemacht. Wenn man erlebt, wie fünf-, sechsjährige Kinder hinter deinem Lkw herrennen und um Wasser betteln, das geht einem schon nahe.
ZEITmagazin: Sehen Sie Deutschland anders seitdem?
Legionär: Schon. Ich sehe Deutschland nicht in einem schlechten Licht, ich glaube, wir Deutschen sind gern unzufrieden mit dem, was wir haben, obwohl es uns sehr gut geht wirtschaftlich. Ich streite nicht ab, dass es nicht allen gut geht, aber man muss sich über die Verhältnisse klar werden. In anderen Ländern werden Leute verfolgt wegen der Religion, der Ethnie, Massenmorde sind an der Tagesordnung und hungernde Kinder. Trotzdem verlernen es diese Menschen nicht zu lachen, was erstaunlich ist, besonders in Afrika ist mir das aufgefallen – und dann steht man hier in Hamburg in der S-Bahn und guckt in die trübseligen Gesichter mancher Menschen in Anzügen und Krawatten und denkt sich: Wow, geht’s uns wirklich so schlecht?
ZEITmagazin: Leben Sie im Gefühl, das Härteste hast du erlebt, härter kann’s nicht kommen?
Legionär: Ich denke, es kann immer was Härteres kommen. Es gibt andere Schicksalsschläge, die einen runterreißen können, etwa einen Menschen zu verlieren. Aber es gibt in Deutschland eine gewisse Sicherheit. Man kann hier in Zeitspannen denken: Was mache ich in fünf Jahren, in zehn? In anderen Ländern geht’s darum, wo kriege ich in diesem Moment mein Essen her. Wenn man so etwas mal erlebt hat, sieht man die Dinge gelassener.
ZEITmagazin: Können Sie mit dem Wort Demut etwas anfangen?
Legionär: Ich empfinde mich selber nicht als demütig. Dazu bin ich nicht religiös genug.
ZEITmagazin: Warum haben Sie die Legion verlassen?
Legionär: Die Idee ist in einem Urlaub aufgekeimt, 40 Tage im Jahr stehen dem Legionär zu, die er in Frankreich verbringen muss. Ich habe mich nicht daran gehalten und bin nach Deutschland gefahren, aus Sehnsucht nach der Familie. In meiner Heimatstadt habe ich mich verliebt und beschlossen, ganz zurückzugehen.
ZEITmagazin: Wie lange waren Sie da bei der Legion?
Legionär: Ungefähr dreieinhalb Jahre. Der erste Vertrag gilt für fünf Jahre.
ZEITmagazin: Und wie sind Sie so früh rausgekommen?
Legionär: Ich bin in einer Nacht-und-Nebel-Aktion mit einem großen Rucksack über den Zaun gesprungen, aus der Kaserne in Frankreich geflüchtet, habe ein Taxi zum Bahnhof genommen und mich dort versteckt. In Frankreich fällt man mit meinem Haarschnitt sehr schnell auf. Man weiß sofort, das ist ein Fremdenlegionär. Ich habe mich dann in den Zug über Straßburg nach Deutschland gesetzt.
ZEITmagazin: Ohne Zwischenfälle?
Legionär: Glücklicherweise ja. Die Gendarmerie hat mich kurz angesprochen, aber die sind relativ handzahm, wenn man sagt, dass man bei der Legion ist. Die stellten keine weiteren Fragen.
ZEITmagazin: Wie denken Sie heute darüber, dass Sie heimlich Ihre Familie verlassen haben?
Legionär: Es war ein wahnsinniger Fehler, niemanden zu informieren, nicht mal eine Nachricht zu hinterlassen: Mir geht’s gut, bin bald wieder da, ich melde mich. Ich glaube, es hätte meiner Familie enormen Trost gegeben, von mir so eine Botschaft zu haben. Ich hab’s nicht getan, meine Familie hat sehr darunter gelitten. Meine Mutter konnte zeitweise nicht arbeiten gehen, sie war krank, ich denke, auch mein Vater hat gelitten, obwohl er weniger offen mit seinen Gefühlen ist. Er ist einer, der die Dinge für sich selber verarbeitet. Ich denke, ich habe viel von ihm, was das betrifft.
ZEITmagazin: Würden Sie es wieder tun?
Legionär: Stünde ich noch mal an diesem Punkt, ich glaube, ich ginge wieder zur Legion. Diese Erfahrung hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Es war eine harte Zeit, trotzdem möchte ich sie nicht missen. Ich bereue den Schritt nicht, ich bereue die Art, wie ich ihn getan habe. Ich hätte eine Nachricht hinterlassen müssen. Einfach so wegzugehen, damit tut man Menschen wahnsinnig weh, das hat keiner verdient. Das habe ich gelernt.
ZEITmagazin: Haben Ihnen Ihre Eltern verziehen?
Legionär: Ja. Es war eines der ersten Dinge, die sie mir sagten, dass sie mir nicht böse sind, weil ich den Schritt getan habe, dass sie einfach nur froh sind, dass ich da bin und es mir gut geht.
ZEITmagazin: Ist das Verhältnis seither belastet?
Legionär: Es ist wahrscheinlich besser als vorher. Man hat immer zwei Wege: Man kann sich verschließen oder versuchen, mit den Situationen umzugehen und daran zu wachsen. Ich glaube, wir sind alle daran gewachsen – ich sehr stark auf jeden Fall.